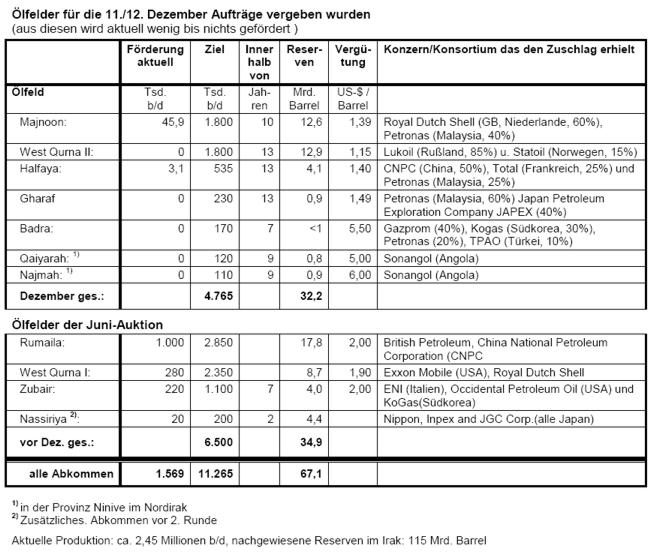Henry Rousseau - Der Traum
Ursprüngliche Akkumulation ist ein schmutziges Geschäft. Die Verleugnung über die „von Kopf bis Zeh, aus allen Poren, schmutz- und bluttriefend[en]“ (Marx, Kapital I, 788) Fundamente kapitalvermittelter bürgerlicher Freiheit machten Marx und Engels zu einem Hauptanliegen in ihren Schriften. Die gewaltsame Verschiebung von Bauern in England wurde als Mordbrennerei zugunsten des europäischen Wollbooms organisiert, den Unwillen der Arbeitslosen domestizierte Edward VI. mit drakonischen Maßnahmen (Marx, Kapital I, 763).
Und so rational und unvermeidlich die effizientere Nutzung der nord- und südamerikanischen Weiten durch die einströmenden, landlosen europäischen Massen war, so pathologisch verlief die rassistisch unterfütterte Landnahme, die ein verhandelbares ökonomisches Konkurrenzverhältnis zwischen Jäger- und Sammlertum und moderner Agrikultur in eine hässliche Serie von durchaus gegenseitigen Massakern und Vernichtungskampagnen verwandelte. In Südamerika dauern diese Indianerkriege bis heute an.
Das Unbehagen über solche Prozesse spürt die bürgerliche Gesellschaft, weil sie ihr Selbstverständnis einer freien und gleichen, durch Konkurrenz stabilisierten Gesellschaft trübt. Sie hatte historisch kein Äquivalent anzubieten, das die Aufgabe des Jäger- und Sammlertums zugunsten der Arbeit in Minen unter Tage oder der Zerschindung von Menschen in Kautschukplantagen attraktiv erscheinen ließe – der Rassismus diente sich als Legitimation an, das Unmenschliche den zu Tieren und Dingen Erklärten antun zu können, weil die technologische Überlegenheit es erlaubte. Das technologisch-kulturelle Experiment „Avatar“ ist Ausdruck und Folge dieses schlechten Gewissens.
Avatar trifft eine im ganzen Manierismus noch deutliche Aussage über die (Un-)Verhandelbarkeit von Interessen in einem assymetrischen Konflikt zwischen einer hochgerüsteten Industrie-Gesellschaft und einer Jäger- und Sammlergesellschaft.
Der Kapitalzweck wird als abstraktes Prinzip benannt: die „Aktionäre“ und die historisch entstandenen Bedingungen auf dem Planeten Erde. Verleugnet wird nicht, dass dieses abstrakte Prinzip pathologische Charaktere hervorbringt und sich ihrer bedient. So stereotyp der narzisstische Wut ausstrahlende Machtmensch in seiner Kampfrüstung gezeichnet wird, so verharmlosend ist das Bild noch gegenüber jenen realen, historischen Indianerschlächtern und Sklavenhändlern. Stellt Star Wars noch interessante, mythologische Figuren des Bösen auf, wagt es Avatar den Stellvertreter des Kapitalinteresses als so belanglos, austauschbar und langweilig zu zeichnen, wie sie wirklich sind. Diese beiden Prinzipien, kultiviertes Desinteresse und individuelle, berechnend überschnappende Pathologie auf Seiten der Exekutive, sind die beiden Elemente, die mit dem enormen Potential der Produktionsverhältnisse ausgestattet mörderisch wurden und werden. Was diesem Verhältnis gegenübertritt, wird von ihm notwendig angesteckt, hat gar keine andere Wahl, als sich pathologisch daran aufzurichten, wenn es nicht in nicht minder pathologischer Agonie erstarren will.
Die beiden Rousseaus sind theoretische und ästhetische Grundlagen, von denen Avatar zehrt. Mit Jean-Jacques Rousseau lässt sich Avatar so kritisch wie affirmativ lesen, was den entsprechenden Experten überlassen bleibt, die den Wandel von amour soi zur amour propre, von Vergesellschaftung und Instinkten nachzeichnen können. Jenseits des Skeptizismus Rousseaus gegenüber einem Naturzustand zeichnet sich in Avatar Intelligenz innerhalb der naivisierten indigenen Welt durch Konfliktvermeidung aus, nicht durch Beherrschung. Der Urzustand wird als mit ins Äußerste räuberischer Natur versöhnter visualisiert und erotisiert – aggressive Komponenten können in ihrer Reduktion auf Nutzbarmachung geleugnet werden. Das furchtbarste Raubtier wird in dieser Idealisierung noch schön wie die Tiger und Panther des Meisters der Grüntöne, Henry Rousseau. Das Ganze wird zum Gegenstand in HD und 3D wie der Maler einst Hintergrund und Einzelheit gleichermaßen scharf zeichnete. Besonderes gibt es nur im Spiel mit anderem Besonderen, ein Vorrecht wird allein dem Ambiente zugestanden, in dem das Individuum sich trotz der Appliziertheit nur akzidentiell aufzuhalten scheint, aufgrund irgendeiner Erlaubnis, die aus undurchsichtigen Gründen und auf Abruf erteilt wurde.
Doch dieses Versöhnungsidyll ist so brüchig, dass nur der reine Stil des medialen Zaubers es verkitten kann. Das Traumhafte rechtfertigt die Ausnahme von der Realität und ist doch von dieser schon ins Korsett gedrängt. Die Phantasie lebt von einem phallischen Unterwerfungsakt, der keine rationale Idee von Gesellschaft voraussetzt, sondern nur ein spezielles Ökosystem. Weil die Ressource des Idylls eine biologische Vorraussetzung ist, bleibt als einzige Möglichkeit an diesem teilzuhaben die Verwandlung in einen anderen, weniger verwundbaren Körper – es gibt kein Rousseau’sches Sofa im Dschungel, die Raubtiere kennen Hunger, aber kein Erstaunen.
Die Unterwerfung der Tiere selbst ist als Abbild der derzeitigen Produktionsmittel gestaltet und so hochtechnologisch wie sexualisiert ausgestaltet – „herunterladen“ könne man letztlich die Informationen aus der Natur, die dem profanen Supercomputer, zu dem die vollends aufgeklärte Mythologie ihren Gott erklärt, gleichgemacht wird. „Verlinken“ eröffnet den Gesunden, Starken die Vernutzung der schicksalhaft bereitgestellten Ressourcen. Das erlaubt die Großartigkeitsphantasie, nach der ein bestimmter Humanoid die Krone der Schöpfung sein soll und es erlaubt zugleich die Verspiegelung dieser Großartigkeitsphantasie durch die Unterwerfung unter ein großes Kollektiv im echtesten Latour’schen Sinne.
Diese Janusköpfigkeit ist das Element eines anderen Phänomens, das im zwanzigsten Jahrhundert die ursprüngliche Akkumulation an blutiger Hässlichkeit noch überbot – der nationalistische Faschismus. Wie bei diesem bedarf es erst der externen Bedrohung und des mit narzisstischen Attributen überschütteten Führers, um Einheit unter den konkurrierenden „Stämmen“ zu erzeugen. So kalt der desinteressierte Kapitalverwalter die Ausbeutung der Ressourcen organisiert, so emotionslos geht der zum Anführer etablierte Außenseiter zur Verwaltung seiner propagandistisch aufgeputschten indigenen Truppen über, opfert sie in sinnlosen Gemetzeln. Der Gang durch die ehrfürchtigen Reihen zum Endziel der Geliebten ist derselbe wie der an anderen Gräbern desinteressierte durch einen Friedhof. Der Blick des Führers hebt sich entrückt zu einem fernen Ziel, während alle ihn anstarren, für den sie doch nur dasselbe Mittel zum Zweck sind wie die unterworfenen Tiere. Dass weder Schauspielern noch Regisseur ein anderer Ausdruck einfallen wollte bezeugt die Wirkungsmächtigkeit der Pose und die Vernabelung mit einer alltäglichen, massenhaften Erfahrung: ignoriert zu werden obwohl man doch selbst alle Aufmerksamkeit widmet.
Die Verherrlichung des Lebens in der Natur auf Pandora ist eine der Jugend. Stärke und Schönheit machen den edlen Wilden aus, solange er nicht gerade Verräter und Dämonen zur Hinrichtung vorbereitet wie später die Inquisitoren und Revolutionäre. Im Alter ersetzt dann Autorität Sexualität. Da man sich als mit dem Tode versöhnt gibt, bedeuten Krankheit und Schwäche nur einen negativen Kontostand in einer Welt, in der man alle Energie von einer Art natürlichen Bank geborgt haben will und irgendwann seine Hypothek im verwirklichten Äquivalententausch einlösen muss.
Es gibt schlimmeres als den Tod. Soviel ist daran wahr, dass aller technischer Fortschritt nichts wert ist, solange das Leben kein wirkliches ist. Solange haben die Kolonialisten auch nichts weiter anzubieten als „alkoholfreies Bier und Jeans“ und nur die Abwertung als verlaust und stinkend kann das eigene Leben als besser erscheinen lassen. Was die Indigenen auf Pandora anbieten ist der gleiche Zauber in bunt. Hat die eine Seite dicke Hubschrauber, kann die andere mächtige Tierwesen auffahren. Wie auf der einen Seite jene mit dem prunkvollsten Kraftfahrzeug beeindrucken wollen, so erfüllt auf der anderen Seite der größte Flugsaurier den gleichen Zweck. Beim Anblick des unterworfenen gelblichen Raubtieres ist die Indianertochter flugs versöhnt und darf mitfliegen. So wird der Versuch, endlich emanzipierte Frauenfiguren in Filme einzuführen letztlich doch zunichte gemacht, nicht zuletzt dadurch, dass keine anderen emanzipierten Männerrollen zu vergeben waren als das Kind, dessen unschuldiges Spiel mit der Kastrationsdrohung beantwortet wird.
Das mag am ökofeministischen Einfluss liegen, der das Gaja-Ideologem aufbereitet. Natur kann nur als technisiertes Konzept bestehen. Diese Einheit von Humanoid und Natur sei „kein heidnischer Voodoo-Zauber“, sondern messbar, real. Die Abgrenzung erfolgt zu zwanghaft, um glaubhaft zu werden. Das gesamte Filmprodukt ist ein einziger Zauber, der sich in diesem Zitat vergewissern muss, dass seine Idee keine esoterische, magische sei.
Interessanterweise wird in dieses Pathos ein Thema eingeflochten, das eher ein seltenes im Film ist, das der Ethnologie. Deren zweckrationaler Einsatz des Verstehens muss scheitern, wo er nur als sparsamerer Weg zur Beherrschung gewählt wird. Soviel ist wahr an der Kritik. Der theorielose, spielerisch-naive Charakter entspricht dem derzeitig propagierten Ideal eines Feldforschers in einer sich gegen Theorie abdichtenden Ethnologie. „Going native“ ist die Folge, wo die eigene Gesellschaft als unbeherrschbar empfunden wird, die zugewiesene Rolle in der Fremde die in der eigenen Gesellschaft an Dienstgrad und Lustgewinn bei weitem übertrifft. Vom querschnittsgelähmten, befehlsgebundenen Marine zum kraftvollen, elastischen Anführer mit Kohlefaserverstärkten Knochen – es bedarf keines besseren Gesellschaftsmodells und erst recht nicht der Einsicht in dieses, um diesen Tausch attraktiv erscheinen zu lassen. Würde der Film also wirklich an seine vorgeschützte Gesellschaftskritik glauben, würde er nicht dieses Sonderangebot auf ein besseres Leben auffahren müssen.